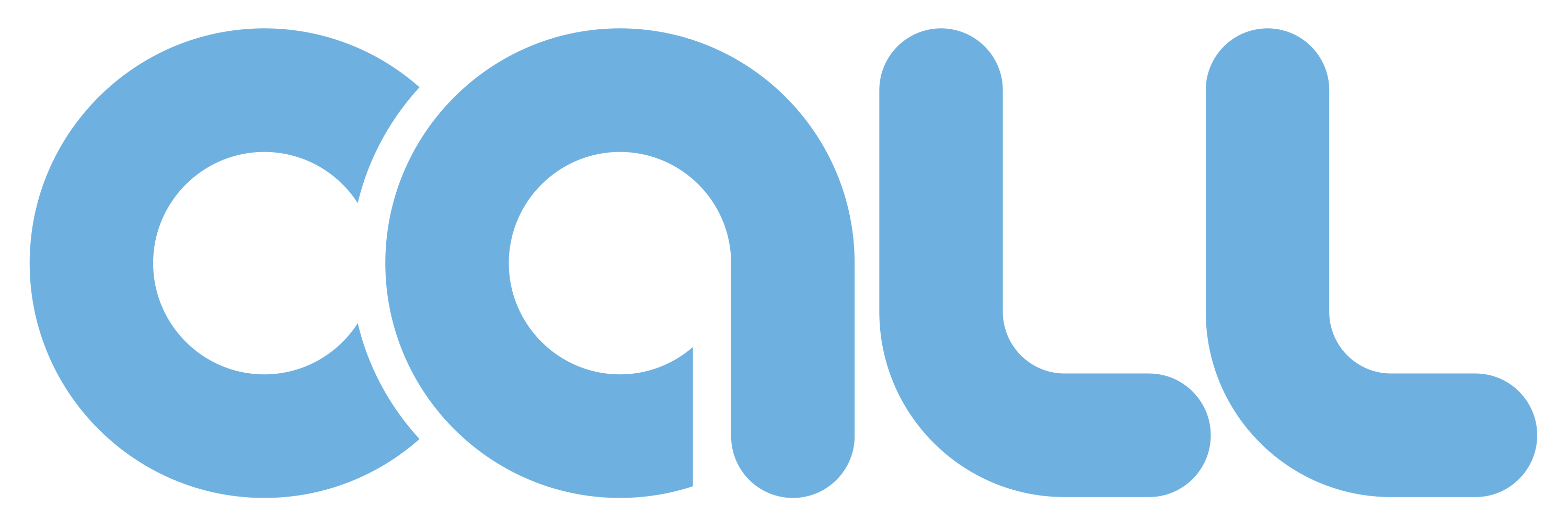Sie erzielten mit der Fußball-Europameisterschaft Rekordquoten: Das letzte Spiel der österreichischen Nationalmannschaft hatte 2,4 Millionen Zuschauer und belegt Platz 6 in der Geschichte des heimischen Fernsehens. Kann man so einen Erfolg überhaupt planen?
Ferdinand Wegscheider: Man kann es nicht wirklich planen. Man kann einen Rahmen planen, der Rest ist Hoffnung. Das passiert ja in einem Abstand von mehreren Jahren. Wie bis dahin die österreichische Nationalmannschaft performt, weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht. Auf das kann man nur hoffen. Was man natürlich planen kann, ist die eigene Performance. Mit der sind wir durchaus sehr zufrieden. Das bestätigt uns auch das Feedback, das wir in den vergangenen Tagen und Wochen bekommen haben. Wir hatten ein unglaublich tolles, unglaublich motiviertes Team. Die mussten wirklich reinbeißen, das war harte Arbeit, aber machte trotzdem auch sehr viel Spaß. Den unglaublichen Spirit spürte man im ganzen Team.
Es gibt einerseits die Quoten, anderseits auch die Berichterstattung auf ServusTV, die – was die Qualität anbelangt – hoch gelobt wurde. Was machen Sie anscheinend besser?
Goetz Hoefer: Ich würde nicht sagen besser. Ich würde sagen anders. Ich spreche nicht über andere und beurteile nicht deren Arbeit. Weil ich denke, dass der ORF sich, genauso wie wir, im Medienmarkt nach bestem Wissen und mit aller Anstrengung und Leidenschaft bemüht. Ich glaube, ein Unterschied ist, dass wir die Spiele der Europameisterschaften gefeiert und auch jede Mannschaft mit einem gehörigen Respekt behandelt haben. Auch das transportieren wir, was Fußball sein soll: Er soll Spaß machen. Dieses Gefühl gaben unsere beiden Experten, Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund, mit einer unglaublichen Leidenschaft weiter.
Die EM-Rechte waren ein anonymisiertes Bieterverfahren. In Wahrheit war es kein Millionen-Unterschied, sondern eine sehr knappe Geschichte.
Viele fragen sich: Wie haben Sie die EM-Rechte eigentlich bekommen? Haben Sie einfach viel mehr bezahlt, wie der ORF kolportiert?
Wegscheider: Über genaue Zahlen wollen wir nicht sprechen. Aber man kann schon so viel sagen, dass es ein anonymisiertes Bieterverfahren war und man weiß nicht, wie viel der jeweils andere bietet. Wenn man zu wenig bietet, dann kriegt man die Rechte nicht. Was natürlich in der anderen Richtung auch sehr schlecht wäre, ist, dass man um viele Millionen zu viel bietet. Das bedarf halt der Erfahrung, des Geschicks, und da sind wir im Sportrechte-Bereich extrem gut aufgestellt, dass man das richtig einschätzt. In Wahrheit war es kein Millionen-Unterschied, sondern eine sehr knappe Geschichte, wo wir halt offensichtlich richtiger gelegen sind.
Hoefer: Da muss man auch mal unsere Sportrechte-Abteilung und David Morgenbesser loben. Wir haben die Rechte niemandem weggeschnappt, weil sie gehören dem ORF nicht. Ein Blick nach Deutschland hätte dem ORF gezeigt, was irgendwann passiert, wenn private Medien halt erwachsen werden. Andererseits muss man auch sagen, dass wir ja mehrere Sportrechte haben. Das heißt, wir schnappen regelmäßig anderen irgendwas weg, aber auch andere uns wie Canal+ die Champions League. Da würde ich jetzt auch nicht öffentlich drüber weinen.

Sie hatten dieses Jahr auch die Formel 1 in Spielberg, die EM ist ein Alltime High gewesen. Wie knüpft man an diese Quoten an?
Wegscheider: Wir haben den Sender in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben weiterentwickeln können. Wir haben in zwei Bereichen gesehen, dass wir wahrscheinlich ganz gut unterwegs sind. Das eine ist, dass die Quoten schon vor der Europameisterschaft im Laufe der vergangenen Jahre, aber auch heuer deutlich angestiegen sind. Das Zweite, was uns enorm freut, ist, dass die Quoten nach solchen Erfolgen nicht wieder in den Keller gehen. Wir haben bei Formaten aus dem Info- und anderen Bereichen diese tollen Einschaltquoten und Marktanteile mitnehmen können. Wir glauben, dass wir nicht nur vom Spirit, sondern vom Gesamtpaket diesen Erfolg auch in die nächsten Monate und Jahre mitnehmen können.
Wenn man sich die Marktanteile ansieht, haben Sie die anderen Privatsender wie die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe längst überholt. Sie sagten mal, das Ziel sei, ORF 1 einzuholen.
Hoefer: Man muss immer Ziele haben. Sonst fährt man im Kreis. Der Erfolg war nachhaltig, das war nicht nur an einem Tag.
Aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal ganz gemein, macht der ORF nichts falsch, er macht alles richtig.
Ist es absehbar, dass Sie ORF 1 überholen werden?
Hoefer: Wie gesagt, da arbeiten ja auch Profis. Ich finde, in Deutschland sieht man das schön am ZDF und an der Situation der Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe, RTL Deutschland und ARD in Summe. Das ZDF hat nach dem Hoch von RTL, die ja Marktführer waren, relativ geschickt in Bereiche investiert, wo sie jetzt regelmäßig Marktführer sind. Das ist für mich der beste Beweis, dass auch öffentlich-rechtliches Programm im Markt erfolgreich sein kann. Aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal ganz gemein, macht der ORF nichts falsch, er macht alles richtig (lacht).
Wollen Sie noch was hinzufügen?
Hoefer: Gerne weiter so (lacht). Immer weiter so. Wir wollen denen jetzt keine Tipps geben.
Wegscheider: Ich hätte es nicht besser sagen können (lacht).
Hoefer: Ob wir sie einholen, ob wir jemals 9 Prozent schaffen, das hängt ja auch mit der Gattung Fernsehen generell zusammen. Das weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Ich glaube nur, es ist immer gut, sich nach oben zu orientieren, nicht nach unten. Per Juni waren wir der Sender in beiden Zielgruppen mit dem stärksten Wachstum. Und das waren wir schon im Mai, also ohne die Euro. Das heißt, es hat jetzt nicht so einen Sporteffekt gehabt, sondern das war schon vorher, dass viele Programme wirklich outperformen. Momentan haben wir da einfach auch Glück, muss man sagen.
Wohin geht diese Programmoffensive? Was wird es für neue Formate geben?
Wegscheider: Über ungelegte Eier reden wir nicht. Was uns sehr freut und viel Spaß macht, ist, dass es auch im fiktionalen Bereich, der lange Jahre nur den Öffentlichen-Rechtlichen vorbehalten war, in den jüngsten Jahren gelungen ist, wirklich schöne Akzente zu setzen und erfolgreiche Produktionen zu machen. Mit tollen Namen, mit den Besten der Branche. Weil gerade im fiktionalen Bereich auch die Schauspieler sehr schätzen, dass bei uns die Qualität immer ganz oben steht. Zum Beispiel Simon Schwarz, das hat uns unglaublich gefreut, hat letztes Jahr bei der Präsentation in Kitzbühel gesagt, er findet es so toll, dass da wieder eine Produktion passiert, wo man sich etwas traut.
Würden Sie sagen, der ORF schwächelt?
Wegscheider: Ich glaube, da sind mehrere Komponenten. Zum einen es ist sehr schräg, dass ich den ORF verteidige. Auf der anderen Seite, ich habe das journalistische Handwerk dort gelernt. Und ich werde oft missverstanden. Wenn man gewissen Machtmissbrauch anprangert, dann glauben viele, man ist generell gegen den ORF oder gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das bin ich nicht. Auf diesem Weg vom Monopol zum Marktführer, wie das Gerd Bacher ausgegeben hat, ist klar: Je vielfältiger die TV-Landschaft wird und je mehr man in einen freien Wettbewerb eintritt, den wir immer noch nicht zur Gänze haben, ist es logisch, dass man Marktanteile verliert. Das ist etwas, das habe ich an mehreren Stellen bemerkt. Es muss ein Bewusstsein her wie in der Schweiz, wo der Öffentlich-Rechtliche irgendwann verstanden hat, man muss die Leute mit Leistung gewinnen, dann werden sie auch nicht auf Dauer davonlaufen. Nur darauf zu beharren: Wir waren immer da, das ist halt zu wenig.

Sie waren in Österreich mit SalzburgTV Privatfernsehpionier. Helmut Thoma erzählt immer gerne seine Geschichte, wie er in einer Garage in Luxemburg mit damals 12 Mitarbeitern RTL gestartet hat. Wie war diese Pionierphase für Sie?
Wegscheider: In Wahrheit hat keiner geglaubt, dass wir das überleben können. Angefangen haben wir mit 3, 4 Mitarbeitern und einem unglaublichen Spirit. Wenn man vorher gewusst hätte, dass es doch ein sehr steiniger, langer Weg wird, weiß ich nicht, ob wir uns darauf eingelassen hätten. Aber wir waren so überzeugt davon, das Richtige zu machen. Und es hat trotz viel Arbeit, eines langen Weges und wirtschaftlicher Katastrophenszenarios über Jahre trotzdem unglaublichen Spaß gemacht. Das haben wir bis zu ServusTV erhalten. Der Applaus ist der beste Lohn für den Künstler. So ist es beim Fernsehen auch. Das positive Feedback, davon lebt man über weite Strecken.
Wie war damals die Initialzündung zum Privatfernsehen in Österreich?
Wegscheider: Ein ehemaliger Kameramann, mit dem wir beim ORF zusammengearbeitet haben, hat sich im Frühsommer 1995 bei mir gemeldet und gesagt: „Jetzt geht es los mit Privatfernsehen.“ Ich habe mir gedacht: Habe ich was versäumt? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass sich sechs kleine Kabelbetreiber in der Steiermark, die immer wieder Standbilder mit Musik gespielt haben, zusammengeschlossen haben und bis zum Verfassungsgerichtshof gegangen sind, weil sie sagten: „In meinem eigenen Kabelnetz kann doch das ORF-Monopol nicht gelten.“ Da stand unmittelbar ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs bevor. In Salzburg war der größte Kabelbetreiber damals schon die Landesstromgesellschaft, heute Salzburg AG, die begonnen hat, kleine Kabelbetreiber aufzukaufen und zusammenzuschließen. Ich habe mir gedacht, es schadet ja nicht, wenn ich dort einmal beim Vorstand vorstellig werde und sage: „Wir sind drei ehemalige ORF-Journalisten. Wenn es einmal losgeht, wir sind bereit.“ (lacht) Zu meiner großen Überraschung hat der Vorstandssprecher gesagt: „Wann könnt ihr denn anfangen?“ Ich antwortete: „Wie, anfangen? Sie wissen, es ist verboten. Und Sie als Landesstromgesellschaft werden ja nicht…“ Er fiel mir ins Wort: „Das lassen Sie meine Sorge sein. Ich habe gefragt, wann könnt ihr anfangen?“ „Jederzeit.“ (lacht) Er: „Nächste Woche?“ Dann habe ich gesagt: „Im Hochsommer fängt man im Fernsehen ja kein Format an und schon gar keinen Sender, weil da sind die Leute im Gastgarten oder im Bad. Nach dem Sommer, im September.“ So ist Salzburg TV entstanden. Ich bin halt dann auf einer griechischen Insel gesessen und habe das Logo gezeichnet. Wir haben dann im September im Salzburger Pinzgau, also in einem Gebirgsbezirk, weil der war am besten verkabelt, mit einer einstündigen Wochensendung angefangen. Sechsmal am Tag in Dauerschleife, dazwischen Panorama-Wetter. Das war der Beginn.
Sie sind ja einmal sogar in Hungerstreik getreten.
Wegscheider: Die Stadt Salzburg war damals extrem schlecht verkabelt, nur 9 bis 10 Prozent der Haushalte hatten Kabel. Das war ein Riesennachteil für jemand, der von Werbung lebt. Jetzt haben wir halt jahrelang gekämpft, endlich einen terrestrischen Sender zu bekommen und 1999 begonnen Unterschriften zu sammeln. Wir plakatierten „Freiheit für Privat-TV“ und haben dann im Jahr 2000 nicht am Gaisberg, weil da steht der ORF-Sender, sondern am Untersberg einen Sender bauen lassen. Wir sind mit den ersten 30.000 Unterschriften nach Wien gefahren zum damaligen Bundeskanzler Schüssel, unangemeldet: „Wir errichten einen Sender und werden demnächst terrestrisch zu senden anfangen.“ Und der Schüssel hat damals gesagt: „Ich kann euch das nicht in die Kamera sagen als Bundeskanzler, noch ist es verboten. Aber fangt an, es wird nichts passieren.“ (lacht)
Typisch Österreich.
Wegscheider: Wir haben am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2000, terrestrisch zu senden begonnen. Am Vorabend haben wir in der Stadt 10.000 Flugblätter verteilt. Und entgegen der Prognose des Bundeskanzlers, aber auch des Landeshauptmanns, ist am nächsten Tag die Funküberwachung da gewesen. Am Montag haben sie angerufen, sie sind jetzt am Untersberg, ich kann noch raufkommen, aber der Sender wird abgeschaltet. Danach, beim Einfahren in die Talstation mit der Gondel, habe ich gesagt: „Wir machen einen Hungerstreik.“ Und weil es halt nicht im Sommer war, sondern schon Ende Oktober, was im Freien schwierig ist, haben wir uns bei einem guten Kunden von uns, einer Baufirma, einen alten Container geliehen, diesen am Alten Markt vors Café Tomaselli hingestellt mit einer Webcam und dann bin ich eingezogen und habe hungergestreikt. (lacht) Von Wien, Berlin bis Zürich haben die Kollegen berichtet, nur die Salzburger und der ORF haben es totgeschwiegen.
Wie ist es ausgegangen?
Wegscheider: Nach 14 Tagen passierte dieses furchtbare Unglück in Kaprun mit 155 Toten, da hab ich aufgehört. Ein halbes Jahr später gab es endlich ein Privatfernsehgesetz. Wir konnten, glaube ich, schon einen Teil dazu beitragen.
Streaming verändert unser Fernsehverhalten völlig. Mit Servus On haben Sie eine Streaming-Plattform aufgebaut. Sehen junge Menschen überhaupt noch linear fern?
Hoefer: Die letzten Wochen der EM haben es ja gezeigt. Da sieht man auch, wo die Stärken des linearen Fernsehens sind, nämlich Rituale zu schaffen, Events zu schaffen, Live-Übertragungen zu ermöglichen. Wir können ja mal die Zahlen vergleichen jetzt, wo Amazon Prime Wimbledon überträgt, und seinerzeit, als RTL das in Deutschland gemacht hat. Jetzt waren es vielleicht hunderttausend Leute bei Wimbledon, bei RTL anfangs drei Millionen. Das ist genauso, wenn Magenta ein Euro-Spiel überträgt. Die freuen sich, wenn sie 50.000 Views haben. Ich glaube schon, dass Fernsehen, genau wie Print, auch in 15 Jahren immer noch seine Existenzberechtigung hat. Netflix produziert halt für einen globalen Markt, für 147 Länder. Da fehlt die Identität. Das wird Fernsehen immer können, genau wie Radio, es wird nie verschwinden.
Wegscheider: Ein ehemaliger Landeshauptmann hat immer gesagt, seine Maxime ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Der ORF hat die letzten Jahrzehnte sowohl im Radio- als auch im Fernsehbereich den Bereich Volkskultur, Brauchtum, Tradition extrem eingeschränkt, teilweise Sendungen völlig ersatzlos aufgehoben. Wir sehen, dass unsere Freitag-Hauptabend-Linie Heimatleuchten nicht nur generell eine tragende Säule des Senders geworden ist, sondern dass diese von den Jungen extrem geschaut wird.
Hoefer: Zweites Beispiel: Nachrichten. Reportagen, die wirklich zugeschnitten sind auf Österreich, wird ein großer Streamer nie machen. Ich sage auch, dass es gerade in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Gerade diese Länder tun gut daran, an diesem festzuhalten und sich nicht nur von Unternehmen abhängig zu machen. Auch eine Bundesliga zu zeigen, was andere vielleicht nicht können, weil die Refinanzierbarkeit schwierig ist, oder Reportagen zu machen ist der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da sind wir heute ja teilweise öffentlich-rechtlicher als der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Sie haben von Ritualen gesprochen. Früher gab es den Samstagabend, ich denke an „Wetten, dass..“, wo schon mal 20 Millionen Menschen vor dem Fernseher gesessen sind. Das gibt es heute kaum mehr.
Hoefer: Diese Euro hat gezeigt, dass im Wohnzimmer wieder alle zusammenkommen und gemeinsam schauen. Die Euro in Deutschland hat das geschafft.
Herr Doktor Wegscheider, Sie haben Ihre eigene Sendung, „Der Wegscheider“. Manche lieben Sie für den Klartext, andere hassen Sie. Wie wichtig ist Polarisierung? Sie selbst bezeichnen das ja als Satire.
Wegscheider: Ich habe die Sendung schon bei Salzburg TV vor 25 Jahren begonnen.
Das Sendungskonzept war damals wie heute, nicht zu polarisieren, sondern einfach meine Meinung zu sagen.
Wie eine Kolumne?
Wegscheider: So ist es. Der Kommentar an sich braucht noch gar keine Satire zu sein, da braucht man nur ins Lexikon zu schauen, der gibt ausschließlich die subjektive Meinung des Autors wieder. Und wir haben damals wie heute Wert darauf gelegt, dass eben der Kommentar als Meinung gekennzeichnet ist und die Berichterstattung möglichst objektiv und äquidistant zu erfolgen hat. Das ist etwas, was ich vielen Mitbewerbern vorwerfe, dass sie im Nachrichtenbereich genau das vermischen und genau diese Trennung nicht machen. Das ist das eine. Satire ist etwas, was meinem Naturell auch entspricht. Und manchmal ist die Lage heute so trist, dass ich sage: Mit Humor schaffe ich es eher, über diese Dinge zu reden. Und da finde ich die Satire ein tolles Instrument, weil sie de facto halt durch Überhöhung und Übertreibung Missstände anprangert und kritisiert. Wenn man sich die Medienlandschaft in Österreich anschaut, habe ich den Eindruck, dass zwischen 95 und 98 Prozent der Medien alle in eine Richtung rennen, politisch überkorrekt. Da habe ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt einer von den restlichen zwei, drei Prozent bin, dass ich bei einem Kommentar jetzt auf Ausgewogenheit schauen muss. Sondern dass es eher angesagt ist, gegen den Wind zu rufen. Dass natürlich in der Branche die anderen 95 Prozent unterstellen, das wäre bewusste Polarisierung, damit kann ich leben.
Hoefer: Bei ServusTV ist es so, wir haben eine Positionierung, wir haben auch ein Redaktionsstatut. Als unabhängiges Medienunternehmen unterliegen wir da keinem Zwang. Wir haben eine politische Haltung. Bei uns kann jeder Politiker mit uns reden, wenn er mag. Und natürlich haben wir eine Grundhaltung als Sender, die jetzt nicht gerade die woke Haltung trifft, weil wir gendern nicht. Wir wollen das bewusst nicht tun, weil das ist für mich auch linguistisch komplett falsch. Und als Medium sollte man nicht erziehen. Das ist ganz falsch.
Welchen Stellenwert haben die Salzburger Festspiele für einen Sender mit Sitz in Salzburg?
Wegscheider: Für die Identität des Senders sind sie sehr wichtig.
Zielt die Entscheidung, den ehemaligen Staatsoperndirektor Holender bei den Festspieltalks durch Lilian Klebow zu ersetzen, auf ein breiteres Publikum ab?
Hoefer: Als ich gekommen bin, haben wir uns das ganze Programm einmal angeschaut. Wo sind wir gut, wo sind wir schlecht? Und ich glaube, man muss dem Doktor Holender auch wirklich für seine lange Zeit, in der er das gemacht hat, danken. Es ist immer auch wieder eine Inhaltsfrage. Diese wirkliche Hochkultur ist für eine Nische der Bevölkerung und für den Rest ja eigentlich unzugänglich oder unverständlich. Wir wollen das einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Wir machen Kultur, möchten aber das Wörtchen „Hoch“ nicht in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg in diesem Jahr. Dass wir mit Lilian Klebow zueinandergefunden haben, waren glückliche Umstände (Anm.: Die PANAREA Studios, die auch das Magazin CALL verlegen, produzieren ihre neue ServusTV-Serie „Roadshow“). Und wir freuen uns da sehr, dass wir mit ihr auch jemanden haben, der das wirklich hervorragend auch anderen näher bringen kann. Es ist ein Riesenunterschied, wer es macht.